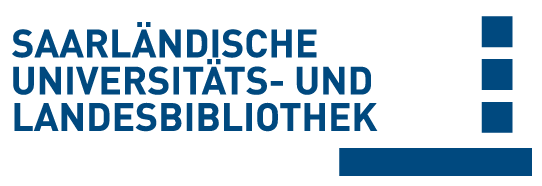Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-46559 | Titel: | Genetic Features of Staphylococcus aureus from Tanzania: Strain-Specific Phenotypic Behaviors Typing of S. aureus within the African-German StaphNet Consortium |
| VerfasserIn: | Kazimoto, Theckla |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Erscheinungsort: | Homburg/Saar |
| DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
| Dokumenttyp: | Dissertation |
| Abstract: | The Gram-positive bacterium Staphylococcus aureus is a common colonizer of mammals and is regularly found in humans, particularly in the nasopharynx, on the skin, and in the intestine. At the same time, this bacterium is a feared cause of a large number of different infectious diseases that occur both in the community and in the hospital environment. The bacterial species exhibits a high degree of genetic heterogeneity and differs in the repertoire of genes that code for virulence factors. On the genetic level, the species S. aureus can be divided into different clonal complexes (CCs) or sequence types (STs) using modern typing methods. While the genetic composition of CCs/STs circulating in society or the hospital environment is well studied for the Western world, our knowledge of the genetic composition of CCs/STs circulating in the community/healthcare system is quite fragmentary for many regions of Africa. Similarly, very few phenotypic studies exist on the virulence characteristics of S. aureus isolates circulating on this continent. Therefore, one of the primary objectives of this PhD thesis was to collect information on the genetic composition of S. aureus strains circulating in Tanzania and their virulence potential. A second aim of this dissertation was to investigate whether there are differences in the composition and virulence potential of S. aureus isolates circulating asymptomatically in the community or causing infections in Tanzania, and which antibiotic resistances can be found in these isolates.
For this purpose, I collected S. aureus isolates that on the one hand led to community-acquired infections in the Bagamoyo area and on the other hand originated from asymptomatic (nasal) carriers. These isolates were subsequently genotypically characterized using DNA microarray technology, and a representative selection of these isolates were phenotypically examined using various test methods with regard to their virulence potential and antibiotic resistance profile. For the latter investigations, a selection of isolates collected and genotypically characterized by the African-German StaphNet Consortium was added. These investigations revealed that the S. aureus strain repertoire circulating in the Bagamoyo area of Tanzania is very heterogeneous on the genotypic level. At the CC level, CCs 152, 121, 8, 15, 88, and 5 were the most commonly found CCs in this region, each accounting for between 13 and 9%. Interestingly, the two most frequently found CCs, CC152 (13%) and CC121 (12%), were preferentially isolated from infection, while isolates of CCs 15 and 8 were mainly obtained from asymptomatic carriers. Concerning the virulence factor repertoire, larger differences could be identified between the individual isolates, but also at the CC level, which were particularly striking with regard to the repertoire of cell-damaging toxins such as hemolysins and leukocidins. For example, the majority of isolates of CCs 152, 121, 88, 80 and 30 harbored the lukF-PV and lukS-PV genes coding for the Panton-Valentine leukocidin (PVL) subunits F and S, respectively, whose gene products are thought to play an important role in the development of necrotic S. aureus infections. Moreover, unlike almost all other isolates of this strain collection, CC152 isolates harbored an intact hlb gene, whose gene product, -hemolysin, plays an important role in S. aureus biofilm formation and host tissue damage, while the gene seb, which codes for enterotoxin B, was preferentially found in isolates of CC121. Interestingly, all four virulence genes were detected significantly more frequently in infection-associated isolates than in isolates obtained from nasal swabs.
The resistance gene profiles of S. aureus isolates circulating in Bagamoyo, Tanzania, showed a low prevalence for the methicillin-resistance mediating gene mecA (2.7%), but a very high prevalence for the penicillinase gene blaZ (99.6%) and fosB (74%), encoding a metallothiol transferase conferring resistance to fosfomycin. In addition, increased rates of the resistance determinants ermC (56%, mediating macrolide/linkosamide/streptogramin resistance) and tetK (47%, conveying tetracycline resistance) were detected in CC152 isolates. Phenotypic antimicrobial susceptibility testing confirmed the high penicillin-resistance rate (>90%), and revealed considerable frequencies of resistance to the commonly prescribed antibiotics erythromycin (29%), clindamycin (24%), and tetracycline (19%).
My strain-specific phenotypic behavior typing studies of S. aureus isolates circulating in Tanzania and from the African-German StaphNet Consortium revealed that isolates of CC152 had a higher virulence potential than isolates of other CCs in almost all test procedures. Treatment of human erythrocytes with supernatants of CC152 isolates resulted in hemolysis titers that were higher than those induced by isolates of other CCs tested. Similarly, treatment of human keratinocytes with supernatants of CC152 isolates resulted in significantly more cell damage than with other CCs tested. However, when the virulence potentials of the isolates were correlated with their origin, in most of the assays carried out, no clear difference was found with regard to whether the isolates were obtained from infection or isolated from asymptomatic donors.
Taken together, these studies indicate that infections caused by CC152 isolates represent an increased risk for the patient to develop a more severe course of disease. However, the lack of clear differences in virulence potential between isolates recovered from clinical infection and those recovered from asymptomatic donors suggests that commensal isolates have a similar potential to infect humans as infection-related isolates. The very high frequencies of blaZ and fosB in Tanzanian S. aureus isolates indicate that antibiotics such as penicillin and fosfomycin are widely used on the community level in this geographical region. Das Gram-positive Bakterium Staphylococcus aureus ist ein häufiger Kolonisierer von Säugetieren und beim Menschen insbesondere im Nasen-Rachenraum, auf der Haut und im Darm vorzufinden. Gleichzeit ist dieses Bakterium ein gefürchteter Verursacher einer Vielzahl von verschiedenen Infektionskrankheiten, die sowohl in der Gesellschaft als auch im Krankenhausumfeld auftreten. Die Bakterienart selbst weißt eine hohe genetische Heterogenität auf und unterscheidet sich insbesondere in Hinblick auf das Repertoire an Genen, die für Virulenzfaktoren codieren. Die Spezies S. aureus lässt sich mit modernen Typisierungsverfahren in verschiedene klonale Komplexe (CCs) bzw. Sequenztypen (STs) unterteilen. Während für die westliche Welt die genetische Zusammensetzung der in der Gesellschaft oder im Krankenhausumfeld kursierenden CCs/STs gut untersucht ist, ist unser Wissen um die genetische Zusammensetzung der in vielen Regionen Afrikas in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen kursierenden CCs/STs noch sehr fragmentarisch. Ebenso existieren nur sehr wenige phänotypische Untersuchungen zu den Virulenzeigenschaften der auf diesem Kontinent kursierenden S. aureus Isolate. Daher war es eines der vorrangigen Ziele dieser Doktorarbeit, Informationen über die genetische Zusammensetzung der in Tansania kursierenden S. aureus Stämme und deren Virulenzpotential zu sammeln. Des Weiteren sollte im Rahmen dieser Dissertation untersucht werden, ob es Unterschiede in der Zusammensetzung und im Virulenzpotential der in Tansania in der Gesellschaft asymptomatisch kursierenden bzw. infektionsauslösenden S. aureus Isolate gibt und welche Antibiotikaresistenzen in diesen Isolaten vorzufinden sind. Um diese Ziele zu erreichen, wurden von mir S. aureus Isolate gesammelt, die zum einen in der Region Bagamoyo zu aus der Gesellschaft erworbenen Infektionen führten und zum anderen von asymptomatischen Trägern stammten. Diese wurden nachfolgend mithilfe der DNA-Microarray-Technologie genotypisch charakterisiert und eine repräsentative Auswahl dieser Isolate mittels verschiedener Untersuchungsmethoden phänotypisch in Hinblick auf ihr Virulenzpotential und ihr Resistenzprofil hin untersucht. Für letztere Untersuchungen wurde des Weiteren auch auf eine Auswahl von Isolaten zurückgegriffen, die über das Afrikanisch-Deutsche StaphNet-Konsortium gesammelt und genotypisch charakterisiert wurden. Diese Untersuchungen zeigten, dass das in der Region Bagamoyo, Tansania, kursierende S. aureus Kollektiv, genotypisch betrachtet, insgesamt sehr heterogen ist. Auf klonaler Ebene waren in dieser Region vor allem die CCs 152, 121, 8, 15, 88 und 5 vorzufinden, deren Anteil jeweils zwischen 13 und 9% betrug. Interessanterweise wurden die beiden am häufigsten vorgefundenen CCs, CC152 (13%) und CC121 (12%), bevorzugt aus dem Infektionsgeschehen heraus isoliert, während Isolate der CCs 15 und 8 mehrheitlich von asymptomatischen Trägern gewonnen wurden. Auch in Hinblick auf das Virulenzfaktor-Repertoire konnte zwischen den einzelnen Isolaten, aber auch auf CC-Ebene, zum Teil große Unterschiede identifiziert werden, die insbesondere in Hinblick auf das Repertoire an zellschädigenden Toxinen wie Hämolysine und Leukozidine auffällig waren. So wiesen Isolate der CCs 152, 121, 88, 80 und 30 mehrheitlich die für die Panton-Valentine Leukozidin Untereinheiten F und S kodierenden Gene lukF-PV and lukS-PV auf, deren Genprodukte eine wichtige Rolle bei der Entstehung nekrotischer S. aureus Infektionen zugeschrieben wird. Isolate des CCs 152 wiesen zudem, anders als nahezu alle anderen Isolate dieses Stammsets, ein intaktes hlb Gen auf, dessen Genprodukt, das -Hämolysin, wichtige Funktion bei der Biofilmbildung von S. aureus und der Schädigung von Wirtsgewebe übernimmt, während das Gen seb, welches für das Enterotoxin B kodiert, bevorzugt in Isolaten des CCs 121 vorgefunden wurde. Spannenderweise wurden alle vier Gene deutlich häufiger in Infektions-assoziierten Isolaten detektiert als in Isolaten, die aus Nasenabstrichen gewonnen wurden. In Hinblick auf die Resistenzgenprofile der in Bagamoyo, Tansania, kursierenden S. aureus Isolate zeigte sich eine niedrige Prävalenz für das Methicillinresistenz-vermittelnde Gen mecA (2.7%), aber sehr hohe Prävalenzen für das Penicillinase-Gen blaZ (99.6%) und für fosB (74%), welches für eine Metallothiol-Transferase kodiert, die eine Fosfomycinresistenz vermittelt. In CC152 Isolaten wurden des Weiteren erhöhte Raten der Resistenzdeterminanten ermC (56 %, vermittelt eine Resistenz gegenüber Makrolid/Linkosamid/Streptograminantibiotika) und tetK (47 %, vermittelt eine Resistenz gegenüber Tetracyclinen) festgestellt. In meinen phänotypischen Untersuchungen der in Tansania kursierenden S. aureus Isolate zeigte sich, dass Isolate des CCs 152 in nahezu allen Testverfahren ein höheres Virulenzpotential aufwiesen als die Isolate anderer CCs. So führte die Behandlung von menschlichen Erythrozyten mit Überständen von CC152 Isolaten zu einem Hämolyse-Titer, der sich mehrheitlich signifikant von den Hämolyse-Titern unterschied, die mit den Isolaten der anderen CCs ermittelt wurden. Des Weiteren führte die Behandlung von humanen Keratinozyten mit Überständen der CC152 Isolaten zu einer deutlich stärkeren Zellschädigung, wenn mit der Zellschädigung anderer CCs verglichen. Wurden hingegen die Virulenzpotentiale der Isolate mit deren Ursprung korreliert, so zeigte sich in der überwiegenden Mehrheit der Untersuchungen keine klaren Unterschiede in Hinblick darauf, ob die Isolate aus dem Infektionsgeschehen heraus isoliert wurden oder von asymptomatischen Spendern gewonnen wurden. Die antimikrobiellen Empfindlichkeitstestungen bestätigten die hohe Penicillinresistenzrate (>90%) und brachten eine erhöhte Häufigkeit von Resistenzen gegenüber den in Tansania häufig im Klinikalltag genutzten Antibiotika Erythromycin (29%), Clindamycin (24%) und Tetracyclin (19%) zum Vorschein. Zusammengenommen weisen diese Untersuchungen darauf hin, dass Infektionen, die durch CC152 Isolate verursacht werden, ein erhöhtes Risiko für den Patienten darstellen, einen schwereren Krankheitsverlauf zu entwickeln. Das Fehlen eindeutiger Unterschiede im Virulenzpotenzial zwischen aus klinischer Infektion gewonnener Isolate und aus der Nase von asymptomatischen Spendern gewonnener Isolate lässt jedoch darauf schließen, dass kommensale Isolate ein vergleichbares Infektionspotenzial für den Menschen aufweisen wie klinische Isolate. Das häufige Vorkommen von blaZ und fosB in den von mir untersuchten Stämmen aus der Region Bagamoyo, Tansania, weist darauf hin, dass Antibiotika wie Penicillin und Fosfomycin in dieser geographischen Region im Haushaltsgebrauch sehr häufig Verwendung finden. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-465599 hdl:20.500.11880/40814 http://dx.doi.org/10.22028/D291-46559 |
| Erstgutachter: | Bischoff, Markus |
| Tag der mündlichen Prüfung: | 14-Nov-2025 |
| Datum des Eintrags: | 24-Nov-2025 |
| Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
| Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin |
| Professur: | M - Prof. Dr. Sören Becker |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Theckla Selwyn Kazimoto_ PhD Dissertation.pdf | Theckla Selwyn Kazimoto_ PhD Dissertation | 7,72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.